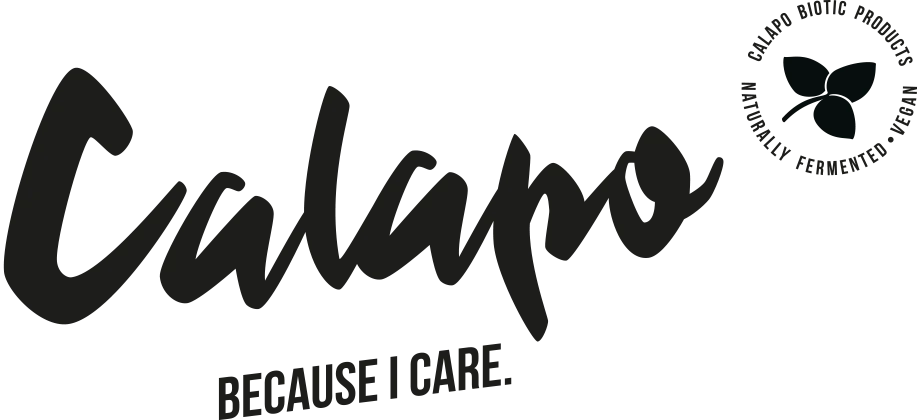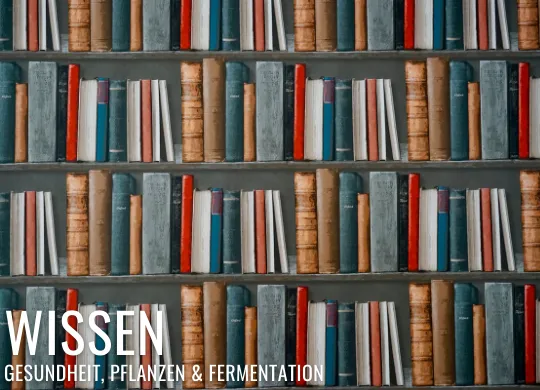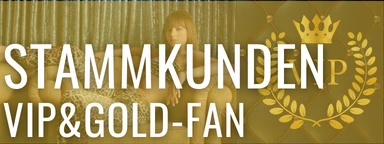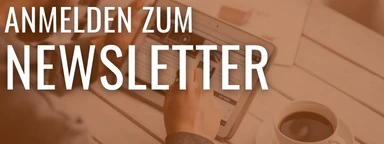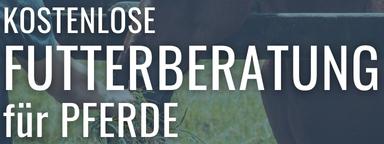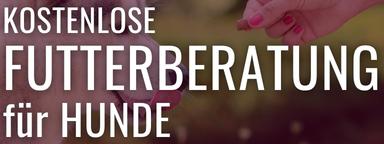Antioxidantien beim Pferd – warum Vitamin E, Vitamin C & Pflanzenstoffe so wichtig sind

Ob im Training, in der Regeneration oder im ganz normalen Alltag: Im Körper eines Pferdes entstehen ständig sogenannte reaktive Sauerstoffverbindungen, oft auch „freie Radikale“ genannt. In kleiner Menge sind sie harmlos – im Überschuss jedoch belasten sie die Zellen. Antioxidantien sind die Gegenspieler: Sie wirken wie eine Art Schutzschild, fangen diese Teilchen ab und halten das innere Gleichgewicht stabil. Wenn es einen Überschuss an Oxidantien gibt, entstehen Entzündungen.
Doch was genau sind Antioxidantien eigentlich, woher bekommt das Pferd sie, und warum ist es in der Praxis so gut wie immer sinnvoll, sie bewusst in die Fütterung einzubeziehen?
Was sind Antioxidantien?
Man kann sich das so vorstellen: Antioxidantien fangen die aggressiven Teilchen ein und machen sie harmlos – wie ein Puffer, der den überschüssigen Funken löscht, bevor er Schaden anrichtet. Ohne diesen Schutz könnten Zellmembranen, Eiweißbausteine oder sogar die Erbsubstanz geschädigt werden. Der Körper verfügt zwar über eigene Abwehrsysteme – bestimmte Enzyme wie die Glutathionperoxidase gehören dazu –, doch er ist auf eine ständige Zufuhr aus dem Futter angewiesen. Hier kommen vor allem Vitamin E, Vitamin C, Selen und eine Vielzahl pflanzlicher Inhaltsstoffe ins Spiel.
Die klassischen Antioxidantien, die man direkt so nennt, sind tatsächlich Vitamin E, Vitamin C, Selen und viele sekundäre Pflanzenstoffe (z. B. Polyphenole, Carotinoide). Das sind die Stoffe, die unmittelbar freie Radikale neutralisieren oder die körpereigenen Schutzsysteme unterstützen.
Welche Rolle spielen Antioxidantien im Pferdekörper?
Ihre Aufgabe ist vielseitig. Vitamin E stabilisiert die Zellmembranen und schützt empfindliche Fettsäuren, besonders in Muskeln und Nervengewebe. Vitamin C ist unentbehrlich für den Aufbau von Kollagen – ohne Vitamin C gibt es keine tragfähigen Sehnen, keine belastbaren Bänder und kein stabiles Bindegewebe. Außerdem hilft es, Vitamin E nach getaner Arbeit wieder zu regenerieren.
Sekundäre Pflanzenstoffe aus Kräutern, Obst, Gemüse oder Gehölzen wie Polyphenole oder Carotinoide erweitern das Schutzspektrum und unterstützen Entzündungsprozesse im Gleichgewicht zu halten. Und Selen? Das Spurenelement ist zwar nur in winzigen Mengen nötig, doch ohne Selen können zentrale antioxidative Enzyme gar nicht arbeiten.
Kurz gesagt: Antioxidantien sichern den reibungslosen Ablauf in allen Geweben – von der Muskulatur über die Entgiftungsorgane bis hin zur Haut.
Woher kommen Antioxidantien beim Pferd?
Das Pferd verfügt über zwei Quellen. Einerseits produziert es selbst welche: In der Leber wird Vitamin C gebildet, und über Enzymsysteme wie die Glutathionperoxidase oder die Superoxiddismutase kann der Körper freie Radikale abfangen. Damit diese Systeme funktionieren, braucht es allerdings Spurenelemente wie Selen, Kupfer oder Zink.
Die zweite Quelle ist das Futter. Frisches Weidegras liefert reichlich Vitamin E, während gelagertes Heu davon deutlich weniger enthält. Kräuter, Blätter und Beeren bringen sekundäre Pflanzenstoffe ins Spiel, die ebenfalls antioxidativ wirken. Auch Lecithin, das in Saaten oder Ölen vorkommt, stabilisiert Zellmembranen und unterstützt die Aufnahme fettlöslicher Vitamine. Man sieht also: Der Körper hat eigene Schutzmechanismen, ist aber auf ständigen Nachschub von außen angewiesen.
Warum reicht die Eigenversorgung oft nicht aus?
Theoretisch klingt es beruhigend: Der Körper stellt Vitamin C selbst her, und auf der Weide gibt es genug Vitamin E. In der Realität sieht das jedoch anders aus. Viele Pferde verbringen den Großteil des Jahres im Stall oder Paddock, und auch bestes Heu verliert beim Trocknen und Lagern einen großen Teil seines Vitamin-E-Gehalts. Auch die körpereigene Vitamin-C-Produktion ist nicht immer ausreichend. Bei Stress, in Zeiten hoher Belastung, im Alter oder während der Genesung kann der Körper nicht genug davon bereitstellen. Genau dann wird Vitamin C für Kollagenaufbau, Schleimhautschutz und Immunsystem besonders wichtig. Die Folge: Ohne gezielte Ergänzung läuft das Pferd schnell in eine Unterversorgung hinein – nicht in Form einer akuten Krankheit, sondern eher schleichend durch langsam wachsenden oxidativen Stress.
Es gibt viele Situationen, in denen Pferde mehr Antioxidantien brauchen als im „Idealzustand“:
- Pferde im regelmäßigen Training: Jede Muskelarbeit erzeugt zusätzliche freie Radikale. Je intensiver und je häufiger gearbeitet wird, desto mehr Schutz ist gefragt – egal ob Freizeit- oder Sportpferd.
- Pferde mit entzündlichen Erkrankungen wie Arthrose, Magenschleimhautreizungen oder chronischen Hautproblemen: Hier laufen entzündliche Prozesse im Hintergrund, die oxidativen Stress verstärken. Zuchtstuten und junge Pferde: Sie brauchen Antioxidantien für Wachstum, Fruchtbarkeit und eine gesunde Entwicklung von Gewebe und Knochen.
- Senioren: Alternde Gewebe regenerieren langsamer, Reparaturprozesse dauern länger – das Schutzsystem braucht Unterstützung.
- Übergewichtige Pferde und EMS-Kandidaten: Stoffwechselstress geht fast immer mit vermehrter Radikalbildung einher.
- Pferde, die unter Starkem Stress stehen, zB durch Schmerzen, psychischem Ungleichgewicht etc.
Warum ist eine Ergänzung fast immer sinnvoll?
Weil fast jedes Pferd heute unter Bedingungen lebt, die seine natürliche Versorgung einschränken. Heu statt Dauerweide bedeutet weniger Vitamin E. Mangel im Futter, Training, Alter, Übergewicht oder chronische Reizzustände bedeuten mehr Bedarf. Selbst Freizeitpferde ohne Turnierambitionen produzieren durch Haltung und Fütterung ein Grundrauschen an oxidativem Stress. Eine maßvolle, konstante Ergänzung füllt genau diese Lücke – nicht als Wundermittel, sondern als stabile Basis für Wohlbefinden und Vitalität. Die generelle Praxis, Problemen durch hochwertige Vitalstoffe vorzubeugen, wie sie auch in der antientzündlichen Fütterung empfohlen wird, greift auch hier.
Welche Pferde profitieren besonders?
Am meisten spürbar ist der Effekt bei Sport- und Distanzpferden, die regelmäßig hohe Leistungen erbringen. Senioren, deren Gewebe langsamer regeneriert, profitieren ebenso wie übergewichtige Pferde mit Stoffwechselproblemen. Pferde mit wiederkehrenden Reizzuständen – sei es Arthrose, Magen, Muskulatur oder Haut – brauchen den zusätzlichen Schutz ebenso wie Pferde, die den Großteil des Jahres mit Heu gefüttert werden.
In welcher Form ist die Zufütterung sinnvoll?
Vitamin E sollte immer mit etwas Fett aufgenommen werden, da es fettlöslich ist. Oft wird diskutiert, ob natürliches Vitamin E besser sei als synthetisches. Fakt ist: Synthetisches Vitamin E kann die gleiche Wirkung erzielen, wenn die Menge angepasst ist. Der Unterschied liegt vor allem in der Bioverfügbarkeit, beide Formen können den Blutzuckerspiegel zuverlässig erhöhen. Natürliches Vitamin E ist aber sehr instabil und zerfällt leicht, während synthetisches stabiler und für viele Allergiker sogar besser geeignet ist. Am Ende ist also nicht entscheidend, ob ein Präparat „natürlich“ oder „synthetisch“ ist, sondern dass es in der richtigen Form, stabil und konstant gefüttert wird.
Vitamin C aus natürlichen Quellen wie Hagebutten wird vom Pferd nur eingeschränkt aufgenommen. L-Ascorbinsäure ist die natürliche Form, die als Pulver eingesetzt und dunkel und kühl gelagert auch sehr stabil bleibt. Grundsätzlich kann das Pferd Ascorbinsäure im Darm verwerten – allerdings nicht unbegrenzt, und ein Teil geht ungenutzt verloren. Wenn die körpereigene Produktion nicht mehr ausreicht, etwa bei hoher Belastung, im Alter oder bei chronischen Problemen, ist eine langfristige Zufütterung in moderater Menge sinnvoll.
Bei Selen gilt: unbedingt die Gesamtration prüfen, da sowohl Mangel als auch Überversorgung problematisch sind. Selen ist Teil wichtiger Schutzenzyme, doch die richtige Menge ist entscheidend: Zu wenig belastet den Stoffwechsel, zu viel kann hochgiftig sein. Ein Blutbild allein reicht zur Einschätzung nicht, da Selen auch im Bindegewebe gespeichert wird. Außerdem hängt seine Verfügbarkeit davon ab, ob andere Mineralstoffe wie Zink oder Kupfer ausreichend vorhanden sind. Deshalb sollte Selen immer im Kontext der gesamten Ration beurteilt werden – nicht auf Verdacht.
Welche Formen von Selen gibt es?
In Futtermitteln kommen verschiedene Selenquellen vor. Häufig wird anorganisches Selen wie Natriumselenit eingesetzt. Es ist günstig, wird aber nicht so effizient gespeichert und kann bei zu hoher Dosierung schneller problematisch werden. Organisches Selen (z. B. Selenhefe, bei der Selen in Aminosäuren eingebaut ist) gilt als naturnäher und besser verwertbar. Es wird im Körper leichter eingelagert und steht dadurch langfristig zur Verfügung.
Lecithin ergänzt die Versorgung sinnvoll, wenn Öl in der Ration ist und die Aufnahme fettlöslicher Vitamine unterstützt werden soll. Lecithin fungiert als natürlicher „Transporthelfer“ und verbessert die Resorption im Darm. Damit kommt mehr vom zugesetzten Vitamin tatsächlich im Körper an. Lecithin gehört außerdem zu den Phospholipiden und ist ein zentraler Baustein der Zellmembranen. Zusammen mit Vitamin E trägt es dazu bei, dass Zellhüllen elastisch und durchlässig bleiben. Damit ergänzt es die antioxidative Wirkung perfekt: Vitamin E schützt vor oxidativen Schäden, Lecithin sorgt für die strukturelle Stabilität.
Kostenlose Futterberatung holen